|
Der
letzte Polynesische (Mikronesische) Navigationskünstler
von Bobby Schenk
Wer
sich etwas näher mit Navigation befasst, wird über kurz oder lang mit den
Geheimnissen der "polynesischen" Navigation konfrontiert. Denn die
Frage drängt sich auf, wie die Südseeinsulaner die einzelnen zahlreichen
Inseln und Inselchen besiedelt haben. Fanden - viele hundert Jahre vor Kolumbus
- zielgerichtete Seefahrten statt, oder handelt es sich schlicht um
Unglücksfahrten, die zur Ausbreitung menschlicher Besiedlungen im Pazifik
geführt haben?. Eine direkte Antwort darauf gibt es nicht, denn die Menschen im
Pazifik haben vor dem 18. Jahrhundert keine geschriebenen Sprache gekannt und
sonstige Spuren in die frühe Vergangenheit fehlen fast völlig. Der Autor hat
während seines mehrjährigen Aufenthalts in Polynesien natürlich versucht, hier
mehr Licht - für ihn ganz persönlich - ins nautische Dunkel zu
bringen...
Zielnavigation
oder Zufall?
Die ersten Erkundigungen in dieser
Frage führten ins Leere. Im recht wissenschaftlich ausgestalteten offiziellen Museum in
Tahiti , dem "Musée
de Tahiti et des Iles", wird das Thema "polynesische Navigation" (gemeint ist
natürlich auch die der Mikronesier) schlicht ausgeklammert: Kein Hinweis auf
den Gebrauch von ausgehöhlten Kokosnüssen als Richtungsanzeiger, keine
Sternkarte mit den sagenhaften "Leitsternen", keine Matte mit
Muscheln als Seekartenersatz gibt eine Antwort darauf, wie die Insulaner so
"zielsicher" andere Inseln hinter dem Horizont auffinden
konnten.
Auch
bei James Cook, unbestritten der größte Nautiker des 18.Jahrhunderts und
früher Besucher Tahitis zu nautischen Zwecken (Meridiandurchgang der Venus),
finden sich zwar akribische Zeichnungen von der lokalen Botanik, aber so gut wie nichts
über die Navigation der Insulaner, soweit sie über die Nachbarinseln hinaus
geführt hat.
 Das
problematischeste Navigationsgebiet stellten bis zur Einführung des GPS, wohl
die Tuamotus dar, ein Inselgewirr von allein 76 Inseln, mit unberechenbaren
Strömungen und häufigen Regenschauern, die oft genug den Blick auf die Palmen
und damit auf die Insel verwehrten. Vor GPS war es durchaus üblich, dass
potentielle Weltumsegler ein paar Wochen bis zum Halbmond warteten, um untertags
einen Schiffsort zu bekommen. Das Ehepaar Koch, hochgeachtete Weltumsegler der
60er Jahre, fand die Navigation in den Tuamotus damals so schwierig, dass sie
keine einzige Insel der Gruppe anliefen. Das
problematischeste Navigationsgebiet stellten bis zur Einführung des GPS, wohl
die Tuamotus dar, ein Inselgewirr von allein 76 Inseln, mit unberechenbaren
Strömungen und häufigen Regenschauern, die oft genug den Blick auf die Palmen
und damit auf die Insel verwehrten. Vor GPS war es durchaus üblich, dass
potentielle Weltumsegler ein paar Wochen bis zum Halbmond warteten, um untertags
einen Schiffsort zu bekommen. Das Ehepaar Koch, hochgeachtete Weltumsegler der
60er Jahre, fand die Navigation in den Tuamotus damals so schwierig, dass sie
keine einzige Insel der Gruppe anliefen.
So dachte ich mir damals, die Kapitäne der
Kopraschoner, die ja regelmäßig die Atolle versorgten, müssten über
"höhere" Navigationskünste verfügen. Aber unser Freund aus Manihi,
Martin,
Skipper eines solchen Schoner, verwies nur auf die "Selected Stars"
der Amerikaner.
Doch,
1980, da traf ich Rodo, der von den Einheimischen ehrfürchtig als der
"letzte Tahitianer, der sich auf die polynesische Navigation versteht"
vorgestellt wurde.
Seinen Ruf hatte er wohl dem im Südpazifischen Raum publizistisch ausgiebig
abgedeckten Unternehmen Hokule'a
zu verdanken, als ein "Kanu" (so nannte Rodo das hölzerne Gefährt)
dieses Namens 1976 von Hawaii aus nach Tahiti gesegelt war. Rodo wurde auf
dieser Fahrt von den Hawaianern deshalb als Vertreter der polynesischen
Navigationselite mitgenommen, weil er mit seinen Ortskenntnissen von den
Tuamotus ein sicheres Eintauchen der Hokule'a
in die polynesische Inselwelt gewährleisten sollte.
 Rodo
war ein netter, redseliger Tahitianer, den man schon gelegentlich an den
Stammtischen der Fahrtensegler im stilvollen Akajou an der Waterfront in
Papeete treffen konnte. Im Schrifttum wird er als "experienced Tahitian
sea captain Rodo Williams" bezeichnet. Rodo
war ein netter, redseliger Tahitianer, den man schon gelegentlich an den
Stammtischen der Fahrtensegler im stilvollen Akajou an der Waterfront in
Papeete treffen konnte. Im Schrifttum wird er als "experienced Tahitian
sea captain Rodo Williams" bezeichnet.
Vieles hörte sich auch aus seinem
Munde sehr interessant an. Dass
zum Beispiel die Inseln im Tuamotu-Archipel lange bevor die
bewaldete Seite als schmaler Saum am Horizont auftauche, zu erkennen
seien.
Wie das? Ganz einfach,
weil sich meist über der Insel eine Wolke befinde, die von der darunter
liegenden smaragdgrünen Lagune angestrahlt werde. Mit diesem Wissen ausgestattet,
konnte ich öfters einen grünlichen Saum an der Wolke beobachten. Auf meinem
alten Weltatlas aus dem Jahre 1890 ist übrigens diese Inselgruppe noch mit dem
alten Namen "Paumotus" bezeichnet, der auf diese Tatsache hinweist:
"Pau" heißt nämlich "Wolke" und Motu ist nichts anderes
als die "Insel", die Inseln unter den Wolken also.
 Schön,
aber damit kann man vielleicht - denn manchmal fehlt die Wolke - eine Insel früh
erkennen, aber navigatorisch bringt einem diese Tatsache nicht viel. Doch,
meinte Rodo, da gibt es viele Anzeichen auf eine nahe Insel: Blätter im Wasser
und Landvögel. Außerdem solle ich mich von meiner
"Instrumentengläubigkeit" (Sextant etc) lösen und die Sterne als
Wegweiser benutzen. Leicht gesagt! Wie soll ich denn einen Sternenhimmel als
Wegweiser benutzen, wenn genau der gleiche Sternenhimmel in exakt der gleichen Nacht
in Botswana, in Peru, in Madagaskar oder auch im Outback in Australien zu sehen
ist. Auf diese Frage antwortete Rodo nicht mehr direkt und verwies auf das über
viele Generationen überlieferte Wissen von den einzelnen Leitsternen. Die
Frage, wieso Menschen die Position von gewissen Sternen an Orten gekannt haben,
wo vorher noch nie Menschen gewesen seien, also die eigentliche Kardinalfrage,
ja, diese Frage überhörte Rodo regelmäßig. Schön,
aber damit kann man vielleicht - denn manchmal fehlt die Wolke - eine Insel früh
erkennen, aber navigatorisch bringt einem diese Tatsache nicht viel. Doch,
meinte Rodo, da gibt es viele Anzeichen auf eine nahe Insel: Blätter im Wasser
und Landvögel. Außerdem solle ich mich von meiner
"Instrumentengläubigkeit" (Sextant etc) lösen und die Sterne als
Wegweiser benutzen. Leicht gesagt! Wie soll ich denn einen Sternenhimmel als
Wegweiser benutzen, wenn genau der gleiche Sternenhimmel in exakt der gleichen Nacht
in Botswana, in Peru, in Madagaskar oder auch im Outback in Australien zu sehen
ist. Auf diese Frage antwortete Rodo nicht mehr direkt und verwies auf das über
viele Generationen überlieferte Wissen von den einzelnen Leitsternen. Die
Frage, wieso Menschen die Position von gewissen Sternen an Orten gekannt haben,
wo vorher noch nie Menschen gewesen seien, also die eigentliche Kardinalfrage,
ja, diese Frage überhörte Rodo regelmäßig.
Das
Unternehmen Hokule'a, das eigentlich der Erforschung der
Südseenavigationskünste dienen sollte, verlief übrigens ziemlich schmählich.
Eine Hawaianische Gruppe versuchte erfolgreich das ganze Unternehmen zu
nationalisieren und verlangte, dass die gesamte Mannschaft für die Weiterfahrt
und nochmalige Fahrt von Hawai nach Tahiti nur noch aus Hawaianern bestehen
sollte. Zu guter letzt wurden als Mannschaft Leute eingesetzt, die nicht einmal
vom Segeln, geschweige von Navigation Ahnung hatten. Ein tödlicher Unfall setzte dem ganzen Unternehmen
schließlich eine tragische Krone auf.
Nun
gibt es bei derartigen Auseinandersetzungen immer wieder Argumente, gegen die
man nicht so leicht ankommt. Als ich unlängst zu diesem Thema einen Vortrag hielt, wandte
sich eine ältere Dame an mich und meinte: "Also ihre Argumente haben mich
ja eigentlich überzeugt! Aber auf einen Umstand sind Sie nicht eingegangen!
Dass es nämlich damals Menschen gegeben hat , die mit übersinnlichen Kräften
ausgestattet waren!"
Recht hatte die nette Zuhörerin, solchen Einwänden lässt sich
nun wirklich kein Argument entgegensetzen - ein Fall für von Däniken!
Trotzdem,
bei solchen Diskussionen tauchen ja immer wieder "sagenhafte Nautiker in
Mikronesien" - präzise "in den Marsschall-Inseln" auf, die über diese
sagenhafte und recht geheimnisvolle Navigationskunst verfügen. Glücklicherweise bin ich
nunmehr hierzu in der
Literatur fündig geworden. Und zwar in einem sehr empfehlenswerten Büchlein
über eine Weltumsegelung mit einer Proa. Diese erfrischende
Schilderung Ennoia mit Kurs auf die Sonne von Wolfgang Vandeck ist nach
langer Zeit wieder erhältlich: Siehe hier. Mit dem Buch werden viele glücklich sein, einen etwas anderen
Einblick in die Welt der Weltumsegler zu finden.
Auch
Vandeck hat sich mit dem Thema "Südseenavigation" auseinandergesetzt
und hat einen dieser Spezialisten in Mikronesien (Kiribati-Inseln) persönlich
getroffen. Er war mit seiner Proa ENNOIA in die Kiribati-Inseln gelaufen (Mikronesien). Das betreffende Kapitel ist mit "Der Navigator" überschrieben. Ich
zitiere, um authentisch zu bleiben, daraus (auszugsweise) wortwörtlich.
Wolfgang Vandeck schreibt:
...Ohne
gute Karten und Satellitennavigation oder wenigstens einen Sextanten hätte ich
nicht gewußt, wie man hier die Atolle hätte finden können. Und doch haben die
Mikronesier - große Seefahrer wie die Polynesier - eben genau dieses Kunststück
fertiggebracht. Sie haben sich nämlich nicht nur von einer Insel zur anderen
gehangelt wie Tarzan von einer Liane zur anderen, sie sind nicht nur Strecken
von 20, 40 oder 80 Seemeilen über den offenen Ozean gesegelt - was angesichts
dessen, daß die niedrigen Atolle nur wenige Meilen zu sehen sind, auch schon
nicht so leicht ist. Nein, die damaligen Seefahrer haben ohne Karten in europäischem
Sinne und ohne Sextant und ohne Kompaß nachweislich regelmäßige
Handelsfahrten auch über mehrere hundert Meilen unternommen. Wie haben sie das
gemacht?
Es hat mich
immer ein wenig geärgert, wenn der - ansonsten von mir geschätzte! - wohl
populärste deutsche Navigationsexperte, Bobby Schenk, die Navigationsmethoden
alter Seefahrervölker jedenfalls in seinen Büchern ignoriert und eher gering
schätzt. Das geht zum Beispiel so weit, daß ein einfaches Instrument zur
Bestimmung der Mittagshöhe (eine Scheibe mit senkrechtem Stäbchen, das beim höchsten
Sonnenstand den kürzesten Schatten wirft) geradezu als eigene ad hoc Erfindung
ausgegeben wird, um von den Kanaren aus Barbados zu erreichen: „Ocean ohne
Compass & Co." Dabei kannten, wie leicht nachzulesen ist, schon
arabische und phönizische Seefahrer dieses Instrument. Man nennt es ein Gnomon.
Die Wikinger nannten es Sonnenschattenbrett und bei den Chinesen war das
einfache Gerät schon vor 600 v.Chr. als Pei bekannt. Und im europäischen
Mittelalter hieß die Weiterentwicklung des arabischen Kamal: Astrolabium,
sozusagen ein einfacher Vorläufer des Sextanten. Warum wird das in einem Buch,
in dem es vornehmlich um Navigation ohne moderne Hilfsmittel geht, nicht
diskutiert oder wenigstens erwähnt?
Heute, da der Fahrtensegler weltweit mit GPS navigieren kann und niemandem etwas
beweisen muß, interessieren mich jedenfalls alternative Methoden gerade unter
historischem - und menschlichem - Aspekt. Vielleicht ist es noch etwas zu früh
es zu sagen, will man niemanden brüskieren, aber eigentlich ist heutzutage
sogar ein moderner Präzisionssextant ein Anachronismus - was natürlich nicht
ausschließt, daß man Spaß daran haben kann.
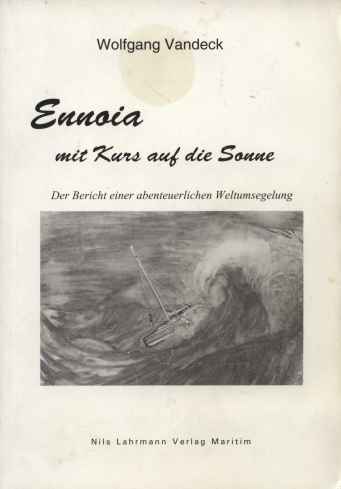 Wenn ich mit meiner kleinen Proa in den Lagunen herumsegelte, fiel das den
meisten Insulanern wohl kaum auf. Denn nach wie vor dominieren in Ozeanien die
Auslegerkanus. Höchstens, daß man sich darüber wunderte, daß mein kleines
Auslegerkanu so "rückschrittlich" war, keinen Außenborder zu haben,
sondern lediglich ein Segel. Das war bei Sione Abera Tewake ganz anders. Er,
etwa 10 Jahre älter als ich, sah meine kleine Proa wohl als eine Hommage an die
Traditionen mikronesischer und polynesischer Seefahrt an - und hatte damit ja
gar nicht so unrecht.
Wenn ich mit meiner kleinen Proa in den Lagunen herumsegelte, fiel das den
meisten Insulanern wohl kaum auf. Denn nach wie vor dominieren in Ozeanien die
Auslegerkanus. Höchstens, daß man sich darüber wunderte, daß mein kleines
Auslegerkanu so "rückschrittlich" war, keinen Außenborder zu haben,
sondern lediglich ein Segel. Das war bei Sione Abera Tewake ganz anders. Er,
etwa 10 Jahre älter als ich, sah meine kleine Proa wohl als eine Hommage an die
Traditionen mikronesischer und polynesischer Seefahrt an - und hatte damit ja
gar nicht so unrecht.
Der mittelgroße ziemlich muskulöse Mann war den Strand bei Bikenibeu (auf
Tarawa) entlang geschlendert, hatte meine kleine Proa dort gesehen und kam nun
zielstrebig auf mich zu, der ich gerade faul im Schatten von Palmen lag und den
lieben Gott einen guten Mann sein ließ. Er trug nur einen Lava Lava, einen
Wickelrock, und war bis zu den Waden hoch sehr stark und auch auf der Brust tätowiert.
Sogar im etwas breiten Gesicht hatte er Tätowierungen. Ohne diese Verzierungen
hätte man ihn wegen seiner Augenform für einen Chinesen halten können.
Allerdings war er etwas dunkelhäutiger.
Er wußte
wohl nicht so recht, wie er ein Gespräch anfangen sollte. Daher ging er erst
einmal um meine kleine Proa herum, betrachtete alles sehr neugierig, faßte
verschiedene Teile prüfend an und schien alles - etwas demonstrativ, kam mir so
vor - zu begutachten. Weil er mit seinem Lava Lava und seinen vielen Tätowierungen
durchaus etwas anders aussah als die Durchschnittsinsulaner, die nämlich
meistens Shorts tragen und weniger Tätowierungen haben, ging ich zu ihm hinüber.
„Guten Tag. Ist das Kanu richtig gebaut?" setzte ich ihn gleich in die
Rolle, die er wahrscheinlich jetzt am liebsten hatte. Ein breites, freundliches
Grinsen war ein Moment lang sein Gesicht. Dann nahm er freudig und wichtig seine
Rolle auf und machte zunächst einmal ein zweifelndes, fragendes „Yes",
und dann in der Intonation konstruktiver Kritik, wie ein Lehrer, der seinen Schüler
zugleich lobt: „we'll see". Nach weiterem Anfassen und Prüfen fragte er
mich schließlich, warum ich den Rumpf so breit gemacht hätte, sogar den
Ausleger. „Das macht das Boot doch so hart, daß du die Wellen nicht mehr mit
den Eiern unterscheiden kannst. Es ist besser, sanft zur See zu sein, sonst sagt
sie dir den Kurs nicht." Ich wurde sofort hellhörig, denn ich hoffte,
vielleicht einen Meister traditioneller Navigation getroffen zu haben. Das ganze
wichtige, betont würdevolle, dabei überlegen-ruhige Gehabe von Sione brachte
mich auf diese Idee, - obwohl ich mir beim besten Willen nicht denken konnte,
was meine Zeugungsorgane mit dem richtigen Kurs zu tun haben sollten. Daher
sagte ich rundheraus: „Ich bin Wolfgang. Es freut mich sehr, dich getroffen zu
haben, denn ich möchte etwas darüber erfahren, wie deine Väter und Großväter
von einer Insel zur nächsten gefunden haben. Kannst du mir darüber etwas erzählen?"
„Natürlich! Es gibt heute in ganz Mirkronesien und Polynesien nur einen Mann,
der soviel Erfahrung und Kenntnisse hat wie ich. Denn mein Vater war Kao Tewake,
der in ganz Ozeanien als großer Navigator bekannt war. Er hat alles von seinem
Vater gelernt hat, der wiederum Chefnavigator und Priester aller Inseln von
Tonga war. Ich stamme auch von dort. Mein Großvater starb leider sehr früh an
Masern, Die Missionare hatten das mitgebracht. - Ich will dich gern
unterrichten, weil du dich dafür interessierst und versucht hast, eine Proa zu
bauen. - Und du könntest mir ein Radio schenken, wie ihr Jachtleute es
habt." Ich beglückwünschte mich erstaunt, daß ich zufällig den größten,
lebenden Meister traditioneller Navigation getroffen hatte, so ganz zufällig.
Dann machte ich Sione klar, daß ich auf meinen Weltempfänger nicht verzichten
konnte, eben weil ich nicht ein so großer Navigator sei noch hoffen könnte, es
in kurzer Zeit zu werden. „Aber ich werde Dir eine anderes Geschenk machen. -
Etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst". Ich hatte zwar noch keine
Idee, was ich ihm schenken könnte, aber das würde sich schon finden. Außerdem
mißtraute ich Sione und seiner vorgeblichen Meisterschaft natürlich: Ein
solcher Zufall war einfach zu unwahrscheinlich.
Ich erfuhr von Sione, warum ein kleines Boot besser sei als ein großes, und
warum man mit einer "richtig" gebauten Proa, die also einen schmaleren
Rumpf haben müsse, also nicht, wie meine, als Gleiter konzipiert wäre, „mit
den Eiern" navigieren könne: „Einmal segelten mein Vater Kao Tewake (Sione
wurde nicht müde, den Namen Tewake zu erwähnen) von der jungen Insel, die
heute Banaba heißt, zurück nach Maiana. Aber schon bald war Tawhiri-matea (der
Gott der Winde) wütend und schickte uns wilde Böen aus Nordwest und so viele
Wolken, daß wir keine Sterne mehr sehen konnten. Denn es war Nacht. Aber das
war kein Problem. Denn etwa alle fünf Minuten spürten wir in den Eiern hoa
delatai, die große Meereswoge, die von sehr weit und immer aus einer Richtung
kommt. Und so wußten wir, welchen Kurs wir zu steuern hatten. Natürlich, das
war ganz leicht. Kurz vor unserem Ziel, sahen wir Tölpel. Die fischen tagsüber
und entfernen sich hier niemals weiter als 20 Meilen vom Land. Also warteten wir
bis zum Abend und folgten dann den Tölpeln, die uns schnurgerade nach Maiana führten.
Tagsüber, wenn man die Wellenmuster sehen kann, ist es natürlich leichter, den
Weg zu finden. Denn dafür haben wir die mattang. Das sind Stabkarten aus
zusammengebundenen Palmwedelrippen mit eingeknüpften Kaurimuscheln für jede
Insel. Natürlich, das ist ganz leicht." Junge Inseln - damit meinte Sione
höhere Vulkaninseln - seien leicht zu finden, denn an ihrer Luvseite stehe
meistens eine Wolke, deren Unterseite grünlich sei. Auch alte Inseln, also
Atolle, kann man auf diese Weise an den Wolken erkennen. An der Unterseite sieht
man dann die Reflexion der helltürkisen Lagune. Nur werden die Wolken über
Atollen nicht festgehalten. „Letzes Jahr bin ich mit meinem Segelkanu zu den höchsten
Bergen der Erde gefahren (Sione meinte damit die über 1500 Meilen entfernten
Marianen, Vulkaninseln, deren Sockel 11km in die Tiefe des Marianengra-bens
reichen). Natürlich, das war ganz einfach, denn ich kannte von Hi-pour, einem
Navigator auf den Karolinen, den richtigen kaveinga. So nennen wir den
Sternenweg. Man richtet den Kurs nach einem Stern aus, der auf dem geplanten
Kurs auf- oder untergeht, - oder man segelt eine Handbreit seitlich davon. Wenn
der Stern zu hoch steigt oder sein Bad im Meer genommen hat, sucht man sich den
nächsten Stern in der gleichen Reihe. In einer Nacht braucht man zwischen 6 und
8 Sterne. Natürlich, das ist ganz leicht. Mein Vater Tewake hat niemals eurem
Kompaß getraut: der kann nämlich die falsche Richtung anzeigen, die Sterne
niemals. Wenn man auch noch weiß, welcher Stern zu einer bestimmten Zeit genau
über einer Insel steht, kann man ganz einfach dorthin segeln, wo der Stern
genau im Zenit steht. Das ist ganz leicht, aber man braucht ein gutes Gedächtnis!
Wenn man
sich alle Sternpositionen merken könnte, wüßte man mit dieser Zenitmethode
ganz ohne eure komplizierten Rechnungen zugleich den Breiten- und den Längengrad,
also den genauen Schiffsstandort. Das ist viel einfacher als mit einem
Sextanten. Und dann habe ich mich auch einfach nach den uloa etahi gerichtet. So
nannte mein Vater Tewake die Tiefseeblitze. Hier in Kiribati nennt man sie te
mata. Sie leuchten eine kurze Zeit lang etwa 2 Meter unter der Wasseroberfläche
auf. Wenn man für eine Gegend ihre Richtung kennt, ist es natürlich ganz
leicht, nach ihnen zu steuern. Denn sie sind in ihrer Richtung stabil. Natürlich,
das ist ganz leicht. Am Tage navigiere ich nach der Sonne und nach Wellen - und
auch nach der Windrichtung, denn jeder Wind schmeckt anders und bringt seine
bestimmten Wolken mit. Wenn die Sonne aufgeht merke ich mir den Kurs am
Schattenwurf des Mastes. Aber man muß sich viel merken können! Auch die Strömungen
muß man kennen: die muß man ausgleichen, indem man zum Beispiel nicht genau
auf den kleinen Bären zuhält, sondern drei Daumen weiter nach Osten steuert.
Sonst kommt man nicht präzise dort an, wo man hin will. Natürlich, das ist
ganz leicht, aber wir haben ein Sprichwort, das mir mein Vater Kao Tewake gesagt
hat: Wenn du wissen willst, wie viele Muscheln auf dem Strand liegen, versuche
nicht, sie zu zählen. Damit meinen wir, daß ein guter Navigator sich nicht auf
einzelne Hinweise verläßt, sondern nur auf alle zusammen. Als mein Vater Kao
Tewake 73 Jahre alt war, sagte er zu mir, daß er sich sehr alt fühlte. Dann
verabschiedete er sich von der Familie und brach mit seinem Kanu zu einer Reise
auf, von der er niemals wiedergekehrt ist".
Sione erzählte
mir noch von so manchem Abenteuer und Navigations-Lehrstück auf See. Demnach mußte
Sione mehr Zeit auf dem Meer verbracht haben, als ein durchschnittlicher
Amerikaner vor dem Fernseher. Je länger er erzählte, desto würdiger und überlegener
wurde sein Gebaren - aber auch desto unvorsichtiger. Denn er lud mich schließlich
zu sich nach Hause zum Essen ein. Zusammen mit seiner Frau und drei Kindern
lebte er keine 500 Meter weiter in einem Zwei-Zimmer-Haus aus Wellblech und
Palmwedeln. Sione begrüßte liebevoll seine kleine, dickliche Frau und noch
liebevoller seine kleinen Kinder.
Wir setzten
uns auf die geflochtenen Matten und aßen Taro, Brotfrucht und Bananen zu einem
Hängen aus dem Supermarkt. In einem winzigen Regal mit den bescheidenen
Habseligkeiten der Familie, neben dem wahrscheinlich immer eingeschaltetem
Fernseher, bemerkte ich ein einzelnes Buch, das schon völlig zerlesen und
abgegriffen war: David Lewis, „We, the Navigators". Und als Sione mich
nach dem Essen gerade wieder hinaus und zurück zu meiner kleinen Proa geleiten
wollte, rief ihm seine Frau hinterher: „Aber bleib' nicht wieder so lange weg:
du mußt noch die Trinknüsse holen. - Seit Jahren sitzt du nur herum und träumst
von großen Seefahrten und tust so, als wärst du, der du nie aus der Lagune
gekommen bist, ein großer Navigator, - anstatt zu arbeiten!" Sie sprach
mikronesisch. Ich hatte aber allein durch den Tonfall und ihre Gestik jedes Wort
verstanden..."
zur
Home-Page
Page by Bobby Schenk
E-Mail: mail@bobbyschenk.de
URL of this Page is: https://www.bobbyschenk.de/n002/navi00.html
Impressum und Datenschutzerklärung
|