Als wir im letzten Jahr in Malaysien, in der
wunderschönen Marina Sebana Cove landeten, war ich bester Stimmung.
Denn der erste Eindruck dieser Marina war großartig und am Schiff schien alles
in Ordnung. Zum ersten Mal seit langem hatte ich keine
"Pflichtenliste" abzuarbeiten. So hoffte ich. Aber es kam ganz
anders....
April 2005
- In der Piratenstraße von Malacca
Ein kurzer Check des Getriebeöls im Saildrive an
Steuerbord änderte alles. Den Ablauf des Abends, der nächsten Wochen und des nächsten
Jahres. Massive Mayonnaise statt klarem Öl fand mein Ölstab. Sofort war klar,
dass dies ein größeres Problem sein würde. Denn durch häufiges Arbeiten
am Unterwasserschiff mit dem Freediver hatte ich mir den einen oder anderen teuren Slipaufenthalt
erspart, aber das weißliche Ölgemisch signalisierte ein großes Problem. Der -
fast immer überflüssige - Blick in die Trouble-Shooting-Liste des Betriebshandbuchs
bestätigte meine Sorgen: "Kontaktieren Sie Ihren Händler!". Immer,
wenn ich derartige Listen checke, ende ich mit diesem völlig wertlosen Hinweis.
Eines war klar: Im Getriebe war Seewasser und das musste sofort raus, wenn nicht die
gesamte Mimik wegkorrodieren sollte. Sagt sich so einfach, aber tatsächlich
ergaben sich nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten. Absaugen über die
Öffnung für den Peilstab ging nicht, und in unmittelbarer
Umgebung dieser Marina gab es keinen Travelift mit der notwendigen Breite für
den Beam der THLASSSA, also für 7 Meter 30. Auch nicht in Singapur! Da war nun
guter Rat teuer.
Den bekam ich von meinen Yachtsfreunden von
der La Rossa und von der Harlekin. Was ich vorher für unmöglich gehalten
hatte, gelang. Nämlich das Öl-Wasser-Gemisch aus dem Saildrive, der ja außen
unter dem Schiff einen halben Meter tief im Seewasser platziert ist, nicht nur
zu entfernen, sondern es auch gegen sauberes Getriebeöl zu ersetzen. Wie? Siehe
Trick-Siebzehn-Kiste!
Das war natürlich nur die halbe Miete. Denn, um
diesen Saildrive wieder einsetzen zu können, musste die Ursache für das Eindringen
gefunden und beseitigt werden. Und das geht halt wirklich nur, wenn das Schiff
auf dem Trockenen steht.
Also, obwohl wir für heuer ganz anderer
Reisepläne hatten (nämlich zurück nach Indonesien zu segeln), mussten wir
umdenken. Wir brauchten in erster Linie einen Platz, wo unser Schiff rausgeholt werden konnte.
Beachen, also am Strand Trockenfallen? Ein halbe Sache, denn der Saildrive sollte ja ordentlich repariert
werden und das geht nicht so auf die Schnelle zwischen den Gezeiten.
 Eine
Werft im Osten Malaysias, nur 200 Meilen von der Sebana entfernt, klärte sich
schließlich bereit, einen Slipwagen für die THALASSSA zu bauen. Doch als es
ins Detail ging, schien mir das alles zu wacklig. Dutzende von
Ratschlägen erhielten wir, wo wir angeblich rauskonnten, aber alle Anfragen
fanden ein schnelles Ende, als die Breite der THALASSA ins Gespräch kam.
Schließlich mussten wir klein beigeben und uns für Phuket, Lumut oder
Langkavi entscheiden. Das waren nicht nur 500 Meilen Entfernung (mit einer
Maschine, denn der zweite Saildrive war ja nicht einsatzfähig), sondern es war
gleichzeitig durch die Straße von Malacca, die einen bodenlosen Ruf genießt
und die ich eigentlich meiden wollte.
Eine
Werft im Osten Malaysias, nur 200 Meilen von der Sebana entfernt, klärte sich
schließlich bereit, einen Slipwagen für die THALASSSA zu bauen. Doch als es
ins Detail ging, schien mir das alles zu wacklig. Dutzende von
Ratschlägen erhielten wir, wo wir angeblich rauskonnten, aber alle Anfragen
fanden ein schnelles Ende, als die Breite der THALASSA ins Gespräch kam.
Schließlich mussten wir klein beigeben und uns für Phuket, Lumut oder
Langkavi entscheiden. Das waren nicht nur 500 Meilen Entfernung (mit einer
Maschine, denn der zweite Saildrive war ja nicht einsatzfähig), sondern es war
gleichzeitig durch die Straße von Malacca, die einen bodenlosen Ruf genießt
und die ich eigentlich meiden wollte.
Diese Seestrasse zwischen Malaysien und
Indonesien ist nicht nur die verkehrsreichste auf der ganzen Welt, sondern
besonders
berüchtigt wegen der zahlreichen Piratenüberfälle. Mehr als 150 waren in den
letzten Jahren verzeichnet worden - ganz offiziell. Allerdings wurden Yachten
getröstet: Es handele sich fast(!) ausschließlich um Überfälle auf die
Berufsschifffahrt und auf Fischerboote. Die Piraten hätten es meist nur auf
Entführungen und Geiselnahmen von Mannschaft und Kapitän abgesehen und deshalb
an Yachten keinerlei Interesse. So kidnappten wenige Wochen zuvor wahrscheinlich
indonesische Piraten einen riesigen malaysischen Schlepper samt Mannschaft. Und dieser
Schlepper ist bis heute verschwunden, obwohl seitens des malaysischen Militärs eine
fieberhafte Suche nach dem Tugboot begann. Das beruhigte uns etwas, denn die Piraten
würden sich bei der erhöhten militärischen Präsenz wohl einige Zeit nicht
aus ihren Schlupflöchern in den Mangrovensümpfen auf der indonesischen Seite
der Malacca-Straße raustrauen. Dachten wir.
 Aber
ein paar Tage später schlugen die Piraten wieder
Aber
ein paar Tage später schlugen die Piraten wieder zu. Was daran besonders übel war, war die Tatsache, dass dieser Überfall auf
einen japanischen Frachter mitten im Verkehrstrennungsgebiet stattgefunden
hatte. Unmittelbar vor dem riesigen malayischen Hafen von Port Klang. Es waren
nur drei Piraten die mit Schusswaffen der 22 Mann starken Crew lächerliche
20000 Dollar abgenommen hatte. Wir hatten andere Sorgen, die THALASSA
musste aus dem Wasser und das war eben nur nach einer Passage durch die
Piratenstraße möglich.
zu. Was daran besonders übel war, war die Tatsache, dass dieser Überfall auf
einen japanischen Frachter mitten im Verkehrstrennungsgebiet stattgefunden
hatte. Unmittelbar vor dem riesigen malayischen Hafen von Port Klang. Es waren
nur drei Piraten die mit Schusswaffen der 22 Mann starken Crew lächerliche
20000 Dollar abgenommen hatte. Wir hatten andere Sorgen, die THALASSA
musste aus dem Wasser und das war eben nur nach einer Passage durch die
Piratenstraße möglich.
Unser Plan war, nur untertags zu
"segeln", denn nachts war - so dachten wir - die Chance, überfallen
zu werden, ungleich größer. Aber das war nicht der einzige Grund, nachts einen
Ankerplatz aufzusuchen, was nicht besonders schwer sein würde, denn
Ankerplätze bei durchgehend zehn bis 30 Meter Wassertiefe in der gesamten
Straße, waren praktisch immer unter den Kielen. Nein, das größere Problem, so
waren wir gewarnt, waren die Fischer und deren wahllos ohne Systematik ausgelegte
Netze, die nahezu überall auch auf Propeller oder Ruderblätter
lauerten und nachts eben gar nicht zu erkennen waren. Was mich aber am meisten
beunruhigte, war die Tatsache, dass ich auf dieser hunderte von Meilen langen
Strecke praktisch nur eine Maschine zur Verfügung hatte, denn der defekte Saildrive war ja
nur konserviert, nicht repariert.
Nun
könnte man sagen, dass ein Katamaran mit einer Maschine ja genauso gut gerüstet
ist wie jeder normale Mono. Das ist nicht richtig, denn ein Kat fährt zwar
unterwegs mit einer Maschine ganz leidlich - ja man merkt nicht einmal die
Assymetrie am Ruder, aber beim Manövrieren ist man erheblich behindert.
Abstoppen des Schiffes mit einer Maschine geht nicht, da würde lediglich das
Schiff zu drehen beginnen. Geradeaus losfahren haut auch nicht hin, denn,
wiederum, beginnt der Kat zunächst zu drehen, bis er endlich drei Knoten Fahrt
zustande bringt, mit denen - bei ruhigem Wetter - er sich auch steuern lässt.
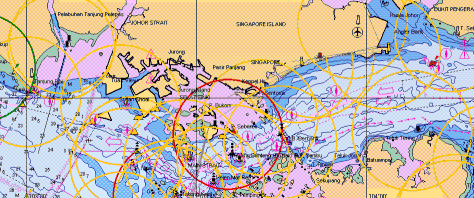 Hinzu kommt, dass man bei dem dichtesten
Schiffsverkehr, den die Welt kennt, ja kein sehr angenehmes Gefühl hat, wenn
man in seiner Manövrierfähigkeit behindert ist. Auf den Zwangswegen, wenn man
denn dorthin abgedrängt wird, kann man nicht erwarten, dass einer der
Riesentanker Rücksicht auf einen nimmt, wenn er überhaupt erkennen könnte,
dass die kleine zweibeinige Spinne unter ihm Schwierigkeiten hätte. Würde auch
gar nichts helfen, denn die Verkehrstrennungssystem sind hier so schmal, dass
ein Großer gar nicht abstoppen könnte, ohne Gefahr zu laufen, einem
Kollegen in die Quere zu kommen.
Hinzu kommt, dass man bei dem dichtesten
Schiffsverkehr, den die Welt kennt, ja kein sehr angenehmes Gefühl hat, wenn
man in seiner Manövrierfähigkeit behindert ist. Auf den Zwangswegen, wenn man
denn dorthin abgedrängt wird, kann man nicht erwarten, dass einer der
Riesentanker Rücksicht auf einen nimmt, wenn er überhaupt erkennen könnte,
dass die kleine zweibeinige Spinne unter ihm Schwierigkeiten hätte. Würde auch
gar nichts helfen, denn die Verkehrstrennungssystem sind hier so schmal, dass
ein Großer gar nicht abstoppen könnte, ohne Gefahr zu laufen, einem
Kollegen in die Quere zu kommen.
 Also,
mit ziemlich schlechtem Gefühl motorten wir aus der Sebana raus in die Straße
von Singapur hinein, wobei wir uns ständig am rechten Fahrbandrand des Zwangsweges
hielten. Es wehte kein Lufthauch, was wir erwartet hatten. Das Wetter war gut, es
war kein Gewitter am Horizont auszumachen, was uns beruhigte, denn während
unseres Aufenthalts in dieser Gegend hab ich eine Menge Respekt vor diesen
gewaltigen Energieentladungen der Natur bekommen. Diese Gewässer gelten als gewitterträchtigstes Gebiet der Welt, was wir
aus der sicheren Marina heraus oft genug beobachten haben können. Den deutschen
Yachten MENEVADO und HARLEKIN wurde es ziemlich hautnah vor Augen geführt, als
beide im gleichen Gewitter Schäden an der Elektronik von einigen zigtausend(!)
Euros erlitten. Vorsoge gegen Gewitter? Fehlanzeige, vielleicht hilft
ja beten!
Also,
mit ziemlich schlechtem Gefühl motorten wir aus der Sebana raus in die Straße
von Singapur hinein, wobei wir uns ständig am rechten Fahrbandrand des Zwangsweges
hielten. Es wehte kein Lufthauch, was wir erwartet hatten. Das Wetter war gut, es
war kein Gewitter am Horizont auszumachen, was uns beruhigte, denn während
unseres Aufenthalts in dieser Gegend hab ich eine Menge Respekt vor diesen
gewaltigen Energieentladungen der Natur bekommen. Diese Gewässer gelten als gewitterträchtigstes Gebiet der Welt, was wir
aus der sicheren Marina heraus oft genug beobachten haben können. Den deutschen
Yachten MENEVADO und HARLEKIN wurde es ziemlich hautnah vor Augen geführt, als
beide im gleichen Gewitter Schäden an der Elektronik von einigen zigtausend(!)
Euros erlitten. Vorsoge gegen Gewitter? Fehlanzeige, vielleicht hilft
ja beten!
Am ersten Tag schafften wir immerhin so an die 60
Meilen. Nicht schlecht für eine Maschine. Die bringt es auf knappe viereinhalb
Knoten. Den Rest verdankten wir dem zeitweise mitlaufenden Strom. Kurz bevor die
Dunkelheit einbrach, fiel der Anker auf wenige Meter - im freien Feld. Komisches
Gefühl, so mitten auf dem Meer zu ankern, aber hier durchaus üblich...
Mit
dem ersten Morgenlicht waren wir schon wieder unterwegs. Dabei gab es am frühen
Morgen eine Schrecksekunde, als der Starter (des "guten" Motors) nur
kurz klickte, aber sonst stumm blieb. Vielleicht hab ich schon an die hundert
Autos in meinem Leben gefahren, aber bei voller Batterie hab ich noch nie
erlebt, dass der Starter nicht wollte. Bei Schiffen sind wir halt - technisch
gesehen - noch ein halbes Jahrhundert zurück. Beim zweiten oder dritten Versuch
zeigte sich das Starterrelais gutmütig, der Startermotor drehte den Diesel
kräftig an. Durchatmen!
 Zwischenzeitlich hatten wir Kontakt zu anderen Yachten aufgenommen. Nein, nicht
über Funk, sondern über Handy, das hier an der gesamten Malaysischen Küste
bestens und ohne nennenswerten Abdeckungslücken funktioniert. Die deutsche
Yacht NIN mit Aline und Michael saß in Port Dixon und die beiden überredeten uns
leicht, in diese Marina zu kommen. Wobei mir bewusst war, dass ein Einlaufen
praktisch nur bei absoluter Flaute für uns möglich war. Aber zunächst hatten
wir andere Schwierigkeiten.
Zwischenzeitlich hatten wir Kontakt zu anderen Yachten aufgenommen. Nein, nicht
über Funk, sondern über Handy, das hier an der gesamten Malaysischen Küste
bestens und ohne nennenswerten Abdeckungslücken funktioniert. Die deutsche
Yacht NIN mit Aline und Michael saß in Port Dixon und die beiden überredeten uns
leicht, in diese Marina zu kommen. Wobei mir bewusst war, dass ein Einlaufen
praktisch nur bei absoluter Flaute für uns möglich war. Aber zunächst hatten
wir andere Schwierigkeiten.
 Wir motorten über das ölige Wasser, als es
plötzlich rummste und ruckelte. Sofort war klar, dass wir von einem Fischnetz
gefangen waren. Glücklicherweise lief die eine Maschine noch, sodass wir möglicherweise mit dem "kranken" Motor das Netz erwischt hatten. Keine
50 Meter von uns entfernt stand ein vielleicht 20 Meter langes Fischerboot mit
der Mannschaft am Heck, die versuchten ihr Netz an Bord und damit uns an ihr
Heck zu ziehen. Es half alles
nichts, ich musste mit Schnorchel und Maske ins schmutzige Wasser. Der Anblick war
unsympathisch. Beide Rümpfe, beide Ruder und nunmehr auch die beiden stehenden
Schrauben waren von einem dichten Knäuel von Leinen mit armdicken Strängen
umwoben. Vom eigentlichen Netz war noch nichts zu sehen, das hing offensichtlich
an dem "Schnürlzeugs". Es dauerte vielleicht eine halbe Stunde, bis
ich die beiden Kiele, die beiden Schrauben und die beiden Ruderblätter unter
ständigem Abtauchen klariert hatte. Das kann sicher auch mit einem langkieligem
Mono passieren, aber bei einem Kat mit "modernem" Unterwasserschiff
hat man halt die sechsfache Chance, hängen zu bleiben.
Wir motorten über das ölige Wasser, als es
plötzlich rummste und ruckelte. Sofort war klar, dass wir von einem Fischnetz
gefangen waren. Glücklicherweise lief die eine Maschine noch, sodass wir möglicherweise mit dem "kranken" Motor das Netz erwischt hatten. Keine
50 Meter von uns entfernt stand ein vielleicht 20 Meter langes Fischerboot mit
der Mannschaft am Heck, die versuchten ihr Netz an Bord und damit uns an ihr
Heck zu ziehen. Es half alles
nichts, ich musste mit Schnorchel und Maske ins schmutzige Wasser. Der Anblick war
unsympathisch. Beide Rümpfe, beide Ruder und nunmehr auch die beiden stehenden
Schrauben waren von einem dichten Knäuel von Leinen mit armdicken Strängen
umwoben. Vom eigentlichen Netz war noch nichts zu sehen, das hing offensichtlich
an dem "Schnürlzeugs". Es dauerte vielleicht eine halbe Stunde, bis
ich die beiden Kiele, die beiden Schrauben und die beiden Ruderblätter unter
ständigem Abtauchen klariert hatte. Das kann sicher auch mit einem langkieligem
Mono passieren, aber bei einem Kat mit "modernem" Unterwasserschiff
hat man halt die sechsfache Chance, hängen zu bleiben.
 Den
nächsten Tag motorten wir nach Port Dixon. Der Windmesser zeigte den
ganzen Tag über nur zwischen drei und sechs Knoten. Aber dieser Hauch war fast
zuviel, um in die Marina einzulaufen. Nur Dank der Hilfe von Michael und anderen
Yachties war es möglich, den Kat in die Box dieser modernen Marina zu
manövrieren. Es ist unglaublich, wie schwer so ein Fahrtenkat, ein riesiger
Windfang, zu handhaben
ist, wenn nur ein Maschine eingesetzt werden kann.
Den
nächsten Tag motorten wir nach Port Dixon. Der Windmesser zeigte den
ganzen Tag über nur zwischen drei und sechs Knoten. Aber dieser Hauch war fast
zuviel, um in die Marina einzulaufen. Nur Dank der Hilfe von Michael und anderen
Yachties war es möglich, den Kat in die Box dieser modernen Marina zu
manövrieren. Es ist unglaublich, wie schwer so ein Fahrtenkat, ein riesiger
Windfang, zu handhaben
ist, wenn nur ein Maschine eingesetzt werden kann.
Port Dixon ist eines jener Mega-Projekte, die in Malaysien zu Dutzenden in der Gegend rumstehen. Meist
finanziert mit Petrodollars scheint es niemand zu stören, wenn diese
Prachtbauten ihre Kosten nicht einspielen.
 Was
zum
Vorteil der Yachtsleute ist, die für wenig Geld eine luxuriöse Bleibe für die
Schiffe finden. Feudale Schwimmbäder - mit Handtuch-Service versteht sich -
stehen dann den paar Seglern kostenlos zur Verfügung. Ein schätzenswerter
Vorteil bei den heißen Temperaturen, die praktisch nie unter 35 Grad am Tag
absinken. Aber auch ansonsten lässt es sich in Malaysien gut leben. Taxis
kosten nur ein paar Pfennige, sodass man sich nicht mal die Mühe machen braucht,
ein Auto billig zu mieten. Für ein paar Euro kann man den halben Tag zum
Einkaufen fahren, während der (Taxi-) Chauffeur geduldig wartet, bis man in den
modernen Supermärkten sich mit preiswerten Lebensmittel eingedeckt hat.
Was
zum
Vorteil der Yachtsleute ist, die für wenig Geld eine luxuriöse Bleibe für die
Schiffe finden. Feudale Schwimmbäder - mit Handtuch-Service versteht sich -
stehen dann den paar Seglern kostenlos zur Verfügung. Ein schätzenswerter
Vorteil bei den heißen Temperaturen, die praktisch nie unter 35 Grad am Tag
absinken. Aber auch ansonsten lässt es sich in Malaysien gut leben. Taxis
kosten nur ein paar Pfennige, sodass man sich nicht mal die Mühe machen braucht,
ein Auto billig zu mieten. Für ein paar Euro kann man den halben Tag zum
Einkaufen fahren, während der (Taxi-) Chauffeur geduldig wartet, bis man in den
modernen Supermärkten sich mit preiswerten Lebensmittel eingedeckt hat.
Eine bedenkenswerte Lebensauffassung hat uns unser
(Stamm-)Taxifahrer über sein Land vermittelt: "Das Hobby aller Malaysier
ist Geldverdienen. Deshalb arbeiten alle Malaysier. Deshalb sind alle Malaysier
happy!"
 Wenn
es denn so einfach wäre! Aber Tatsache ist, dass die Leute hier auf uns einen
wunderbar lockeren, charmanten Eindruck machten. Von Geldgier keine Spur.
Im Gegenteil: Selten waren wir in einem Land, wo wir den Eindruck absoluter
Ehrlichkeit hatten. Dein Schiff brauchst Du hier nicht zu verschließen. Ein
Großteil der Einwohner sind Inder. Obgleich sie gegenüber den Malayen von der
Verfassung eindeutig (noch) benachteiligt sind, spürt man als Besucher
von sozialen Spannungen unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen
nichts.
Wenn
es denn so einfach wäre! Aber Tatsache ist, dass die Leute hier auf uns einen
wunderbar lockeren, charmanten Eindruck machten. Von Geldgier keine Spur.
Im Gegenteil: Selten waren wir in einem Land, wo wir den Eindruck absoluter
Ehrlichkeit hatten. Dein Schiff brauchst Du hier nicht zu verschließen. Ein
Großteil der Einwohner sind Inder. Obgleich sie gegenüber den Malayen von der
Verfassung eindeutig (noch) benachteiligt sind, spürt man als Besucher
von sozialen Spannungen unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen
nichts.
Gewöhnungsbedürftig für Europäer ist das
Auftreten der Frauen, die man praktisch niemals ohne Kopftuch sieht. Die Beine
sind ebenfalls bis zu den Fersen peinlichst verhüllt. Trotzdem machen die
Frauen in der Unterhaltung einen lockeren, keineswegs prüden Eindruck. Ein
wenig zurückhaltend sind sie schon, um nicht zu sagen schüchtern. Unterdrückt wirken sie
jedenfalls nicht.
Drei Tage lang genossen wir diesen herrlichen
Club mit all seinen Annehmlichkeiten, bevor wir uns vornahmen, am nächsten
frühen morgen Richtung Langkavi weiter zu segeln.
zur
Home-Page
Page by Bobby Schenk
E-Mail: mail@bobbyschenk.de
URL of this Page is: https://www.bobbyschenk.de/n000/indi08.html
Impressum und Datenschutzerklärung